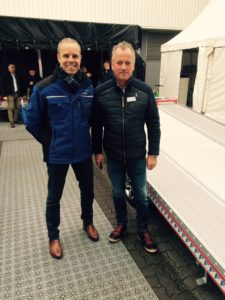Gerüche und Geschmäcker können nicht durch das Urheberrecht geschützt werden. Nach Auffassung des Generalanwalts beim Europäischen Gerichtshof handelt es sich nicht um „Werke“ im Sinne der Urheberrechtsrichtlinie. Grundsätzlich können durch das Urheberrecht nicht Ideen, Verfahren oder Methoden, sondern nur deren eigenständige Ausdrucksformen geschützt werden. Der Geschmack oder Geruch eines Käses kann jedoch nicht mit ausreichender Genauigkeit und Objektivität identifiziert werden. Ebenso wenig kann eine rechtwidrige „Kopie“ festgestellt werden. Dies gilt jedenfalls für den gegenwärtigen Stand der Technik.
Schlussanträge des Generalanwalts vom 25.07.2018, EuGH C-310/17
– Hexenkäse –
Hinweis: Auch die Eintragung von Geruchs- oder Geschmacksmarken (sogenannte olfaktorische Marken) ist nach geltendem Recht (noch) nicht möglich.
Mit Beschluss vom 13.09.2018 hat der Bundesgerichtshof dem Europäischen Gerichtshof mehrere Fragen zur Haftung von YouTube für Urheberrechtsverletzungen vorgelegt.
Anfang November 2008 waren bei YouTube mit Musikvideos von Sarah Brightman eingestellt, darunter auch private Konzertmitschnitte und Musikwerke aus ihren Alben. Dagegen wehrte sich ihr Musikproduzent und verklagte YouTube auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Schadensersatz.
Nachdem das Landgericht Hamburg der Klage hinsichtlich dreier Musiktitel stattgegeben hatte, verurteilte das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg in Bezug auf sieben Musiktitel YouTube dahingehend, es nicht weiter zu ermöglichen, Tonaufnahmen oder Darbietungen von Sarah Brightman aus dem Studioalbum „A Winter Symphony“ öffentlich zugänglich zu machen. Darüber hinaus sollte YouTube Auskunft über die Nutzer der Plattform erteilen, die diese Musiktitel unter Pseudonymen auf ihr Internetportal hochgeladen hatten.
Beide Parteien hatten Revision zum Bundesgerichtshof eingelegt, der Kläger verfolgte seine vollständigen Klageanträge weiter, während die Beklagte die vollständige Klageabweisung erstrebte.
Der Bundesgerichtshof hat das Verfahren ausgesetzt und dem EuGH mehrere Fragen zur Auslegung der Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der Richtlinie 2000/31/EG über den elektronischen Geschäftsverkehr und der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (sogenannte Enforcement-Richtlinie) vorgelegt.
Es stelle sich die Frage, ob der Betreiber einer Internetvideo-Plattform wie YouTube eine Handlung der „Wiedergabe“ im Sinne von Artikel 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG vornehme, wenn er mit der Plattform Werbeeinnahmen erziele, der Vorgang des Hochladens automatisch und ohne vorherige Ansicht oder Kontrolle erfolge, er nach seinen Nutzungsbedinngungen für die Dauer der Einstellung des Videos eine weltweite, nicht exklusive und gebührenfreie Lizenz erhalte, gleichzeitig darauf hinweise, dass urheberrechtsverletzende Inhalte nicht eingestellt werden dürften, er Hilfsmittel zur Verfügung stelle, mit deren Hilfe Rechteinhaber auf die Sperrung rechtsverletzender Videos hinwirken könnten und der Betreiber auf der Plattform eine Aufbereitung der Suchergebnisse in Form von Ranglisten und inhaltlichen Rubriken vornehme und registrierten Nutzern eine an von diesem bereits angesehenen Videos orientierte Übersicht mit empfohlenen Videos anzeigen lasse, sofern er keine konkrete Kenntnis von der Verfügbarkeit urheberrechtsverletzender Inhalte habe oder nach Erlangung dieser Kenntnis solche Inhalte unverzüglich lösche oder unverzüglich den Zugang zu ihnen sperre. Die weiteren Vorlagefragen zielen darauf ab, ob die Tätigkeit des Betreibers in den Anwendungsbereich von Artikel 14 Abs. 1 der Richtlinie 2000/31/EG fällt und ob sich die dort genannte tatsächliche Kenntnis von der rechtswidrigen Tätigkeit oder Information auf konkrete rechtswidrige Tätigkeiten oder Informationen beziehen muss.
Ebenso interessiert, ob es mit Artikel 8 Abs. 3 der Richtlinie 2001/297EG vereinbar ist, wenn der Rechteinhaber gegen einen derartigen Diensteanbieter eine gerichtliche Anordnung erst dann erlangen kann, wenn es nach einem ersten Hinweis auf eine klare Rechtsverletzung erneut dazu gekommen ist. Sollten die vorgenannten Fragen verneint werden, wird gefragt, ob z.B. YouTube unter den o.g. Umständen als Verletzer im Sinne von Artikel 11 Abs. 1 und Artikel 13 der Richtlinie 2004/48/EG anzusehen ist und ob die Schadensersatzverpflichtung nach Artikel 13 Abs. 1 davon abhängig ist, dass der Verletzer vorsätzlich gehandelt hat.
BGH, Beschluss vom 13.09.2018, I ZR 140/15 – YouTube –
OLG Hamburg, Urteil vom 01.07.2015, 5 U 175/10
LG Hamburg, Urteil vom 03.09.2010, 308 O 27/09
Der Betreiber eines Internetzugangs über WLAN und eines Tor-Exit-Nodes haftet nicht als Störer für von Dritten über diesen Anschluss begangene Urheberrechtsverletzungen. Allerdings kann der Rechteinhaber einen Sperranspruch nach § 7 Abs. 4 TMG in der seit dem 13.10.2017 geltenden Neufassung geltend machen.
Der Rechteinhaber des Computerspiels „Dead Island“ wandte sich gegen den Download auf einer Internettauschbörse und mahnte den Anschlussinhaber ab. Der berief sich darauf, die Rechtsverletzung nicht selbst vorgenommen zu haben, obwohl er fünf öffentliche WLAN-Hotspots und zwei Tor-Exit-Nodes betrieb.
Nach § 8 Abs. 1 Satz 2 TMG n.F. haftet der Vermittler eines Internetzugangs nicht mehr wegen einer rechtswidrigen Handlung eines Nutzers auf Schadensersatz, Beseitigung oder Unterlassung. Vielmehr kommt nur noch ein Anspruch auf Sperrung der Informationen gem. § 7 Abs. 4 TMG n.F. in Betracht. Die Sache wurde daher an das zuständige Oberlandesgericht zurückverwiesen.
BGH, Urteil vom 26.07.2018, I ZR 64/17 –Dead Island –
Ob ein Online-Verkäufer als privater oder gewerblicher Anbieter zu behandeln ist, richtet sich nicht allein nach der Zahl seiner Verkaufsanzeigen. Ausschlaggebend ist vielmehr, ob die Verkäufe Teil einer „gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit“ sind.
Gewerbliche Anbieter müssen den gesetzlichen Informationspflichten nachkommen, insbesondere auch eine Widerrufserklärung bereithalten und die Ware innerhalb der gesetzlichen Widerrufsfrist zurücknehmen. Für private Verkäufer gelten diese strengen Vorschriften nicht. So weigerte sich eine bulgarische Verkäuferin, eine gebrauchte Armbanduhr zurückzunehmen und den Kaufpreis zu erstatten. Die bulgarische Verbraucherschutzkommission stufte sie als gewerbliche Händlerin ein, weil sie noch acht weitere Verkaufsanzeigen veröffentlicht hatte.
Dem ist der Europäische Gerichtshof nicht gefolgt. Er stellt darauf ab, ob der Verkauf planmäßig erfolgte, ob er eine gewisse Regelmäßigkeit hatte oder mit ihm ein Erwerbszweck verfolgt wurde und ob sich das Angebot auf eine begrenzte Anzahl von Waren konzentrierte. Zudem müssten auch die Rechtsform sowie die technischen Fähigkeiten des Verkäufers berücksichtigt werden.
Allein die Tatsache, dass ein privater Verkäufer mehrere Verkaufsanzeigen in einer bestimmten Zeit aufgibt, spricht noch nicht für ein gewerbliches Handeln. Hingegen können mehrere gleichartige Anzeigen auf eine gewerbliche, handwerkliche oder berufliche Tätigkeit hindeuten.
EuGH, Urteil vom 04.10.2018, C-105/17.
Auch ein kritischer Blogger verletzt durch den Betrieb der Internet-Domain www.wir-sind-afd.de die Namensrechte der rechtsgerichteten Partei. Er muss in die Löschung der Domain einwilligen und auf sie verzichten. Durch den Domain-Namen entstehe eine sogenannte „Zuordnungsverwirrung“. Allein durch die einleitenden Worte „wir-sind“ entstehe der falsche Eindruck, die Website werde von der Partei selbst oder mit ihrer Zustimmung durch einen Dritten betrieben. Auf den Inhalt der Domain komme es nicht an.
Über die konkreten AfD-kritischen Inhalte der Website musste das Gericht nicht befinden, es hat aber darauf hingewiesen, dass es dem Blogger selbstverständlich frei steht, seine Inhalte unter einer anderen, ebenfalls gut auffindbaren Domain zu veröffentlichen. Dabei darf eventuell auch der Name der Partei verwendet werden, wenn dies mit einem klarstellenden Zusatz geschieht, dass es sich nicht um eine AfD-eigene Seite handelt.
OLG Köln, Beschluss vom 27.09.2018, 7 U 85/18
Vorinstanz: LG Köln, Urteil vom 06.02.2018, 33 O 79/17.
Die Revision gegen das Berufungsurteil wurde nicht zugelassen; der Blogger kann aber noch binnen eines Monats Nichtzulassungsbeschwerde zum Bundesgerichtshof erheben.
Das Angebot der Warn-Wetter-App durch den deutschen Wetterdienst stellt keine unzulässige geschäftliche Handlung nach § 12 Abs. 1 UWG dar. Vielmehr erfüllt der DWD damit seine gesetzlichen Aufgaben zur Erbringung meteorologischer und klimatologischer Dienstleistungen für die Allgemeinheit oder einzelne Kunde und Nutzer. Er erfüllt damit eine konkrete, hoheitliche Aufgabe und tritt nicht als privater Unternehmer auf. Daher ist das allgemeine Wettbewerbsrecht mangels geschäftlicher Handlung nicht anwendbar.
OLG Köln, Urteil vom 13.07.2018, 6 U 1080/17
Auch zur Aufklärung einfacher Verbrechen darf die Polizei den Speicher eines Mobiltelefons auswerten. Obwohl Telefondaten zur Privatsphäre eines Menschen gehören, dürfen sie in bestimmten Fällen zur Strafermittlung benutzt werden. Voraussetzung ist nur, dass das Privatleben der Betroffenen hierdurch nicht stark beeinträchtigt wird.
Die spanische Kriminalpolizei beantragte zur Aufklärung eines Raubes einer Brieftasche und eines Handys die Identifikationsdaten deren Gesprächspartner zu erhalten, die nach dem Raub mit dem gestohlenen Handy angerufen wurden. Während der spanische Ermittlungsrichter den Antrag mit der Begründung ablehnte, es handele sich nicht um eine schwere Straftat, und der Schutz personenbezogener Daten dürfe nur in besonderen Fällen eingeschränkt werden, entschied der Europäische Gerichtshof, dass eine Auswertung zulässig sei. Auch wenn es sich nicht um eine schwere Straftat handele, verbiete nur ein schwerer Eingriff in das Privatleben eine Auswertung. Vielmehr könne der Zugang auch zur Verhütung, Ermittlung und Verfolgung von allgemeinen Straftaten gerechtfertigt sein. Denn die vorliegenden Daten ließen keine genauen Schlüsse auf das Privatleben der Gesprächspartner zu.
EuGH, Urteil vom 02.10.2018, C-207/16.
Auch 2018 betreute Westfalenpatent wieder mehrere Nutzfahrzeug-Hersteller auf der Internationalen Automobil Ausstellung in Hannover (IAA Nutzfahrzeuge 2018). Ob bei den Schwerlastspezialisten, die teilweise draußen im Regen standen, oder bei den Herstellern leichterer Nutzfahrzeuge und Komponenten – es gab wieder zahlreiche Innovationen und interessante Fortentwicklungen zu sehen. Zahlreiche interessante Gespräche mit Entwicklern und Firmeninhabern füllten einen kompletten Messetag und versprechen viel Arbeit in den Wochen danach. Natürlich durfte auch „Schwarz-Gelb“ nicht fehlen.



Auch Nachbauten durften natürlich nicht fehlen. So stand direkt auf der IAA bereits ein verblüffend ähnliches Plagiat eines chinesischen Herstellers des gerade erst neu vorgestellten MAN-Busses der modernisierten „Lion’s Line“.

Vortrag zum Thema „Marken-, Design- und Urheberrecht“
https://startupweek.ruhr/2018/event/marken-design-und-urheberrecht
Die internationale Tabakwarenfachmesse „inter tabac“ in den Dortmunder Westfalenhallen lockte zu ihrem 40. Jubiläum im Jahr 2018 mehr als 550 Aussteller aus aller Welt an. Rechtsanwalt Thomas Meinke war wieder als Messe-Anwalt für die Respektierung des geistigen Eigentums und die Durchsetzung gewerblicher Schutzrechte zuständig. In den vergangenen Jahren musste er regelmäßig wegen der Verletzung von Patenten, Gebrauchsmustern, Marken und Designs einschreiten. Plagiate gab es E-Zigaretten, ebenso wie bei Feuerzeugen, Tabak-Köpfen oder Wasserpfeifen und Shishas. Aber auch Pfeifen und Zigarillos werden weltweit gefälscht und in Dortmund angeboten. Gleichzeitig fand auch noch die „inter Supply“ als internationale Fachmesse für die Produktion von Tabakwaren statt.